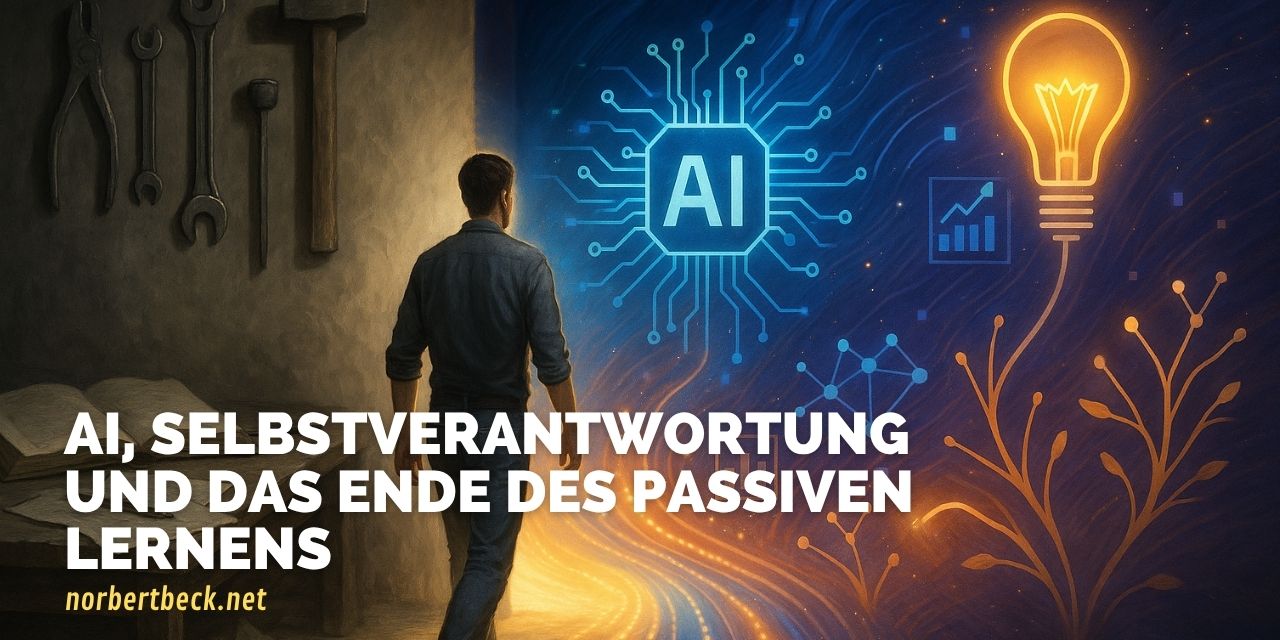Warum „lernen in Eigenregie“ zur Kernkompetenz der nächsten Dekade wird – unabhängig vom Alter
Vor ein paar Jahren habe ich mit Mitte 40 die Verwaltung verlassen und bin in die IT gewechselt. Keine Heldengeschichte, eher ein nüchterner Kurswechsel: Wenn das Umfeld sich verändert, muss man sich mitbewegen. Heute, mit 52, arbeite ich als Softwaredesigner und begleite die AI-Transformation in unserem Unternehmen. Die wichtigste Lektion aus dieser Zeit lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Anpassung ist kein Zusatz, sondern Grundkompetenz.
Je tiefer ich in neue Tools, AI-Workflows und agile Methoden eingestiegen bin, desto deutlicher wurde mir ein Muster: Viele Menschen – jung wie alt – warten auf Anleitung. Sie verweisen auf „das System“, das sie nicht vorbereitet hat, auf Arbeitgeber, die keine Trainings anbieten, oder auf „die böse AI“, die Arbeitsplätze frisst. Verstehen kann ich das. Nur hilft es nicht. Die Arbeitswelt sortiert nicht nach Gerechtigkeitsempfinden, sondern nach Handlungsfähigkeit.
AI ist nicht die Bedrohung – Stillstand schon
Ja, Automatisierung verdrängt Aufgaben, besonders am unteren Ende der Wertschöpfung. Einstiegsrollen in Tech werden rarer, Routine verschwindet hinter Schnittstellen und Skripten. Seriöse Analysen schätzen, dass 6–7 % der Jobs durch AI automatisiert werden könnten – bei breiter Adoption. Das ist spürbar, aber kein Schicksal: Technologiewellen schaffen zugleich neue Tätigkeiten und Produktivitätsgewinne.
Die leisere Bedrohung heißt Skill-Stagnation: nicht mehr zu merken, dass das eigene Werkzeug veraltet; nicht mehr zu testen, ob ein Prozess automatisierbar wäre; nicht mehr zu lernen, weil gestern noch alles „gut genug“ war. Besonders Gen-Z-Tech-Einsteiger bekommen das zu spüren, weil klassische „Junior“-Tätigkeiten zuerst wegautomatisiert werden und der Einstieg härter wird – ein Punkt, den u. a. Goldman-Sachs-Ökonom Joseph Briggs betont.
Verantwortung und Rahmenbedingungen – kein Widerspruch
Es wäre bequem (und falsch), Selbstverantwortung gegen strukturelle Rahmenbedingungen auszuspielen. Zeitdruck, Care-Arbeit, Budgetfragen – das alles ist real. Genau deshalb braucht es pragmatische Strategien, die in vollen Kalendern Platz finden. Verantwortungsübernahme heißt nicht: 20 Wochenstunden „nebenbei“. Es heißt: konsequent kleine Schritte, die sich summieren. Und es heißt, die eigene Lernumgebung so zu gestalten, dass Fortschritt leichter wird als Aufschub.
Von passiv zu proaktiv: drei Haltungen, die den Unterschied machen
1) Initiative statt Wartehaltung
Warte nicht auf ein offizielles Trainingsprogramm. Stell dir ein eigenes Mikro-Curriculum zusammen: ein Kurs, ein Mini-Projekt, ein Austauschpartner pro Monat. Das klingt bescheiden – ist aber die verlässlichste Art, Momentum aufzubauen.
2) Denken in Wertbeiträgen, nicht in Aufgaben
Jobtitel sind Etiketten, keine Grenzen. Frage dich regelmäßig: „Welches Problem löse ich gerade, und wie könnte AI meinen Beitrag vergrößern?“ Das kann eine Automatisierung sein, bessere Dokumentation, ein robustes Testsetup oder ein Leitfaden für Kolleg:innen.
3) Ergebnisse verantworten – inklusive Fehler
Fehler sind Trainingsdaten. Eine gescheiterte Automatisierung sagt dir, wo der Prozess unsauber ist. Ein schlechtes Prompt-Ergebnis zeigt, wo Kontext fehlt. Wer diese Signale systematisch auswertet, lernt schneller als alle anderen.
Mindset-Upgrade: Vom Experten zum Lernarchitekten
Früher war Spezialwissen knapp, heute ist es zugänglich. Was fehlt, ist Architektur: kuratieren, experimentieren, dokumentieren. Wer das beherrscht, bleibt relevant – unabhängig vom Alter. Expertise ist kein Endzustand, sondern ein Produktionsprozess.
Eine realistische Lernroutine, die sich durchhält
– Montag: Wochenziel festlegen, Lernbaustein wählen.
– Mittwoch: Hands-on-Experiment (Prompt verfeinern, kleines Skript).
– Freitag: Kurz dokumentieren: Was hat funktioniert, was nicht, wie belegen wir Wirkung?
Effektiv reichen für jeden dieser Termine etwa 20 bis 30 Minuten. Es geht hier nicht darum Stunden freizuschaufeln. Und die Standardausrede: „Ich habe keine Zeit“ zählt somit auch nicht mehr.
Führung und Kultur: Was Organisationen beisteuern können
Selbstverantwortung ist der Motor, Kultur der Multiplikator. Firmen sollten Micro-Budgets für Lernprojekte schaffen, Brown-Bags etablieren, „Done beats perfect“ sichtbar belohnen und Fehler als Lehrmaterial begreifen. Parallel gilt: Curricula altern schnell – auch Hochschulen müssen sich bewegen und AI-Kompetenzen systematisch lehren.
Schlussgedanke: Souveränität statt Ausrede
AI verändert Arbeit – oft schneller, als uns lieb ist. Aber den Unterschied macht nicht, was sich ändert, sondern wie wir darauf reagieren.
Die entscheidende Frage lautet nicht: „Was nimmt AI mir?“
Sondern: „Was kann ich damit bauen – heute, mit dem, was ich habe?“
Fang klein an. Miss Wirkung. Teile, was funktioniert. Dann wiederhole den Zyklus.
So entsteht das, was ich „Life-Competence“ nenne: Kompetenz, die mit der Welt mitwächst. Ob du 20 bist oder 50.
Quellen & weiterführende Links
• Goldman Sachs Research (Joseph Briggs & Sarah Dong) – How Will AI Affect the Global Workforce?
👉 https://www.goldmansachs.com/insights/articles/how-will-ai-affect-the-global-workforce/
• Goldman Sachs Global Economics Analyst (Devesh Kodnani & Joseph Briggs) – The Potentially Large Effects of Artificial Intelligence on Economic Growth
👉 https://www.gspublishing.com/content/research/en/reports/2023/03/27/d64e052b-0f6e-45d7-967b-d7be35fabd16.html
• Fortune – Goldman Sachs economist: Gen Z tech workers are most affected by AI’s labor market ripple
👉 https://fortune.com/2025/08/06/goldman-sachs-economist-gen-z-tech-jobs-ai-labor-market/
Dieser Text zeigt, wie Co-Creation mit KI funktionieren kann: Auf Grundlage meines eigenen Entwurfs und meiner Ideen half mir KI, Gedanken präziser und wirkungsvoller zu formulieren. Auch das Bild wurde mit KI gestaltet. Genutzte KIs hierbei: ChatGPT5 und Mistral/LeChat.